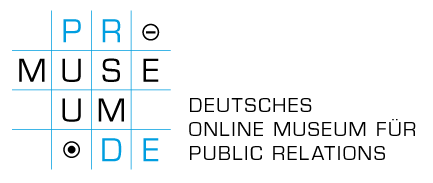Zeitschriften einschließlich Fach- und Organisationspresse
Zeitschriften im „langen“ 19. Jahrhundert
Nach dem durch die Aufklärung verursachten regen Gründungsgeschehen von Zeitschriften im 18. Jahrhundert setzte mit den reaktionären und repressiven Karlsbader Beschlüssen des Deutschen Bundes von 1819 „geradezu ein Niedergang der Zeitschriften“ ein.
Maßnahmen zur teilweisen Liberalisierung 1848/50, das Pressegesetz von 1874 sowie wirtschaftliche Veränderungen „führten dann in der zweiten Jahrhunderthälfte zu einer geradezu stürmischen Gründung neuer Zeitschriften“. Gab es im Jahr 1848 nur 688 Zeitschriften, so stieg ihre Zahl über 1.217 (1867) und 2.727 (1887) auf 4.571 im Jahr 1897 an. 1914, im Jahr des Kriegsbeginns, wurde sogar die Zahl 6.421 erreicht. (Mühl-Benninghaus/Friedrichsen 2012, S. 76f., u. a. unter Rückgriff auf Wilke 1988)
Thematische Ausdifferenzierung der Zeitschriften: Rolle der Medizin
Der Anteil des Themenfeldes „Medizin, Veterinärmedizin“ an den Themenschwerpunkten der Zeitschriften blieb relativ konstant:
- Jahr 1850 = 7,8 Prozent;
- Jahr 1887 = 6,0 Prozent;
- Jahr 1914 = 6,2 Prozent (Mühl-Benninghaus/Friedrichsen 2012, S. 78, unter Rückgriff auf Lorenz 1937).
Die bereits oben für Zeitungen konstatierte Tendenz „mehr Unterhaltung und weniger Politik“ galt noch mehr für Teile des Zeitschriftenwesens, so für hochauflagige „Familienblätter“ wie die „Gartenlaube“ oder Illustrierten. (Schiewe 2004, S. 152) Betrachtet man allerdings die Titelzahlen des gesamten Zeitschriftensektors, so „zeigt die Statistik, dass die Ausdifferenzierung der fachwissenschaftlichen Zeitschriften deutlich höher lag als die der Frauen-, Familien- und Unterhaltungsblätter“.
- Letztere Gruppe (also Frauen-, Familien- und Unterhaltungsblätter) kam im Jahr 1887 auf 7,8 Prozent, also nur etwas mehr als Medizin / Veterinärmedizin (siehe oben).
Hier noch zum Vergleich die Anteile weiterer Themenschwerpunkte für das Jahr 1887:
- Angewandte Wissenschaften (was sich später weiter ausdifferenzieren sollte) = 39,1 Prozent;
- Theologie / Philosophie = 14,2 Prozent;
- Philologie / Pädagogik / Jugendschriften = 11,8 Prozent;
- Recht / Politik / Geschichte / Wirtschaft = 11,5 Prozent;
- Naturwissenschaften = 4,9 Prozent;
- Kunst / Literatur = 4,7 Prozent. (Mühl-Benninghaus/Friedrichsen 2012, S. 78, unter Rückgriff auf Lorenz 1937)
Der Aufschwung der fachwissenschaftlichen Presse ist eine Folge der Wissenschaftsentwicklung.
Wissenschaftsentwicklung der Medizin als wichtiger Publikationstreiber
„In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann die moderne naturwissenschaftliche Phase der Medizin. Physik, Chemie und Biologie befruchteten sie ungemein und führten zu einem neuen Selbstverständnis“ (VMWJ 1994). Manche meinen möglicherweise auch schon eher: „Seit den 1830er Jahren kann man cum grano salis davon ausgehen, dass in der Medizin ein naturwissenschaftliches Gesundheits- und Krankheitskonzept bestimmend war. Dieser auf Zell-Zell-Kontakte, in der Folge dann molekular ausgerichteter Blick prägt bis heute die moderne Medizin.“ (Steger in Wagner-Pischel 2024, S. 74)
Zurück ins 19. Jahrhundert:
Die ersten pathogenen Bakterien wurden entdeckt, die Hygiene begann ihren Siegeszug, und die Chirurgie übernahm mit der neuentwickelten ‚Asepsis‘ (Herstellung von Keimfreiheit – T.L.) die Spitze des medizinischen Fortschritts. Gleichzeitig war die Spezialisierung in immer neue Fachgebiete infolge der ungeheuren Wissensexplosion nicht mehr aufzuhalten.
(VMWJ 1994)
Dies galt gerade auch für Deutschland.
So waren deutsche Forscher in Naturwissenschaft und Technik während des 19. Jahrhunderts weltweit führend. Bahnbrechende Erfindungen wie etwa das Automobil wurden in Deutschland gemacht. Ebenso gelang der nun Durchbruch bei der Heilung zahlreicher Krankheiten Grundlagenforschern und Medizinern aus Deutschland.
(DFJV 2024, S. 6)
Abb.: Wilhelm Conrad Röntgen. Foto von Erwin Hanfstaengl 1888-90. Quelle: Wikimedia Commons. Public Domain.
Wie eng der Zusammenhang zwischen Forschung, Erprobung bzw. Anwendung und Publizität bereits gezogen war, zeigt die Entdeckung der Röntgenstrahlen Ende 1895 (in der referierten Quelle falsch: 1894) durch Wilhelm Conrad Röntgen. Am berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhaus in Halle (Saale) „wandte [Klinikleiter Professor Max] Oberst diese neue Methode an und publizierte bereits am 13. Oktober 1896 in seinem ‚Beitrag zur Verwendung der röntgeschen Strahlen in der Chirurgie‘ die ersten Ergebnisse“. (Bergmannstrost 2024, S. 6; vgl. auch Altena/van Lente 2009, S. 226)
Für die Medizin als Wissenschaft ist aber im 19. Jahrhundert auch eine gewisse Ambivalenz festzustellen. Einerseits baute sie ihre Stellung aus, schuf mehr Aufmerksamkeit und bekam neue Anstöße.
Im 19. Jahrhundert intensivierten sich die Diskussionen durch Arbeiten von Pierre Alexandre, Charles Louis und Ignaz Semmelweis. Weitere Impulse kamen durch die Gründung großer Krankenhäuser, die zunehmende Verfügbarkeit von Gesundheitsdaten und die Entwicklung neuer statistischer Methoden.
(Hastall/Lang in Rossmann/Hastall 2019, S. 16)
Dieser Aufschwung führte bei einigen Vertretern sogar dazu, die Medizin für eine Art „Superwissenschaft“ zu halten, die auch Erklärungskraft und Interventionspotenzial für soziale und politische Aufgaben und Vorgänge besitzt.
Der berühmte Pathologe der Charité, Rudolf Virchow (1821-1902), ebenfalls Politiker und Begründer der Sozialmedizin sei zitiert: ‚Die Medizin ist eine soziale Wissenschaft, und die Politik ist nichts weiter als Medizin im Großen.‘
(Lenz 2024, S. 43, unter Berufung auf Diehl/Gebauer/Groner 2012)
Solche weitreichenden und interdisziplinären Wirkungsvorstellungen erleichterten auch die Übertragung von Lehren und Therapien aus Medizin bzw. Ärzteschaft auf persuasive Kommunikation und insbesondere Anfang des 20. Jahrhunderts auf eine massenpsychologisch begründete Öffentlichkeitsarbeit/PR, wie in der zweiten Hälfte der Einleitung unserer Abhandlung bereits dargestellt.
Andererseits wurde die wissenschaftliche Legitimation der Medizin auch angezweifelt: So (…)
(…) gab es stets auch eine gut aufgestellte Gegenseite, die den Standpunkt vertrat, dass die Medizin keine Wissenschaft sei und dementsprechend nicht wissenschaftlichen Standards oder methodischen Zwängen unterliege (Böhm 1998; Tröhler 1999).
(Hastall/Lang in Rossmann/Hastall 2019, S. 16)
Fachpresse im Gesundheitswesen
„Mit der rapiden Entwicklung der Medizin entstanden immer mehr Spezialverlage und Publikationen. Während die Zahl der deutschen medizinischen Fachzeitschriften 1890 noch etwa 150 betrug, waren es 1904 bereits ca. 204.“ Führende überregionale Organe waren die Deutsche Medicinische Wochenschrift (DMW) aus Berlin und die Münchener Medicinische Wochenschrift (MMW). Beispiele für weitere Titel sind: Berliner klinische Wochenschrift, Medicinisch-chirurgisches Centralblatt Wien, Allgemeine Wiener medizinische Zeitung, Zeitschrift für Krankenpflege, Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und klinische Medizin (seit 1902 Virchows Archiv) … (VMWJ 1994)
Auch andere Quellen nennen Beispiele für medizinische Fachzeitschriften: Graefes Archiv für Opthalmologie (*1854), Zeitschrift für Krebsforschung (*1904) … (Bäder/Cattani 1993, S. 155)
Zugleich griffen Bestrebungen um sich, die Organisiertheit der medizinischen Fachpresse und „ihre Arbeitsbedingungen – besonders bei der Kongressberichterstattung – wesentlich zu verbessern“. Ziel war „eine freie Vereinigung der gesamten deutsch-sprachigen medizinischen Presse – einschließlich Österreichs und der deutschsprachigen Schweiz – […], um deren Interessen stärker vertreten zu können. Als Vorbild diente die seit 1889 in Frankreich existierende ‚Association de la presse médicale‘“.
Am 25. September 1894 gründete sich die Freie Vereinigung der deutschen medicinischen Fachpresse anlässlich der 66. „Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte“ in Wien. Geschäftsführer wurde der Neurologe Prof. Dr. Albert Eulenburg aus Berlin. Zwei Jahre später, 1896, wurden vom Verein bereits 37 Zeitschriften von 39 Mitgliedern vertreten. (VMWJ 1994)
Die berufliche Presse differenzierte sich weiter aus. Dies konnte auch medizinische Berufe betreffen, die speziell von Frauen ausgeübt wurden.
Speziell zur Fachpresse für weibliche Beschäftigte in Österreich heißt es:
Parallel zur steigenden Erwerbsquote von Frauen entwickelte sich ein Segment von Berufsblättern (vornehmlich Vereinsorgane), die entweder allgemeine Themen der Berufstätigkeit von Frauen aufgriffen oder sich spezifischen Berufsgruppen widmeten. In inhaltlicher Hinsicht boten diese Zeitschriften in der Regel einen breiten Überblick über Themen zur standespolitischen Vertretung (insb. Vereinsnachrichten, Berichte aus Fachgruppen), zu Rechtsfragen (Gesetzesnovellen), Standesnormierungen oder zu Bezugsregelungen an.
(Krainer in Karmasin/Oggolder 2016, S. 214)
Im damaligen Österreich bestanden für „die Berufsgruppe der Hebammen“ die folgenden Organe:
- „Erste allgemeine österreichische Hebammen-Zeitung (Wien 1887, Hg.: Stössel, Hiero);
- Hebammen-Zeitung: Organ des Unterstützungsvereines für Hebammen (Wien 1887-1919, Hg.: Gustav Bauer);
- (Die) kluge Frau: Fachschrift für Hebammen, Gesundheitspflege und des Kindes, wie allgemeine Fraueninteressen (Wien 1886-1888, ab dem 2. Jg.: Erste allgemeine österreichische Hebammen-Zeitung. Fachschrift für Hebammen sowie Gesundheitspflege der Frau und des Kindes, wie allgemeine Frauen-Interessen, Red.: Ludwig Pollhammer);
- Brünner Hebammen-Zeitung: Organ der Vereinigung Österreichischer Hebammen mit Sitz in Brünn (Brünn ab 1910);
- Hebammenzeitschrift: Organ für die Interessen der Hebammen Österreichs (Brünn 1907-1912).“ (Krainer in Karmasin/Oggolder 2016, S. 214f.)
Organisationspresse im Gesundheitswesen
Schon im Zusammenhang mit den Hebammen zeigte sich, dass die Fachpresse häufig Verbandspresse war. Nicht nur zur beruflichen Organisation, Binneninformation und Weiterbildung dienten Vereine, Verbände und ähnliche Institutionen als wichtige Träger – und Herausgeber von Medien. Dies galt auch für Zwecke der Außeninformation und Aufklärung aus dem Berufsfeld in die Breite der Gesellschaft, bei Multiplikatoren, Betroffenen etc. Diese Organisationspublizistik war sehr vielfältig.
Ein Beispiel dafür ist die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten (DGBG), die 1902 gegründet wurde und zwar im Nachklang zum ersten Brüsseler Syphiliskongress im Jahr 1899. Die DGBG hatte die „Aufklärung der breiten Bevölkerung über die Gefahren von Geschlechtskrankheiten, auch venerische Infektionen genannt, zu einer wichtigen Aufgabe erklärt“. (Berlekamp 2021, S. 3, in Reifegerste/Sammer)
Medial verfolgte die Organisation eine vielfältige Strategie und wandte sich sowohl an Profis als auch an Laien:
- „Dabei bemühte sie sich um eine möglichst breite Palette an Aufklärungsmedien (Scholz 2003). So brachte die Gesellschaft zwei Zeitschriften heraus, wobei die Zeitschrift für Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten eher wissenschaftliche Beiträge zum Thema veröffentlichte, während sich die Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten eher auf Nachrichten an die breite Öffentlichkeit konzentrierte (Sauerteig, 1999).
- Außerdem gab die DGBG einige Flug- und Merkblätter im kleineren Rahmen heraus, die ebenfalls für die Aufklärung der nicht-wissenschaftlichen Öffentlichkeit aufgemacht waren.“ (Berlekamp 2021, S. 6, in Reifegerste/Sammer)
Neben schriftlichen Medien setzte die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vor allem auf Event-PR:
- „Weiterhin verfügte sie über eine Sammlung von Ausstellungsmaterialien wie Moulagen, Wandtafeln und Diaserien, die sie in Wanderausstellungen in vielen Städten des Deutschen Reiches zeigte.
- Durch die Gestaltung eigener Ausstellungen und eines eigenen Pavillons auf der Internationalen Hygieneausstellung in Dresden 1911 bediente sich die DGBG eines in dieser Zeit überaus beliebten Aufklärungsmediums.
- Sie öffnete die Teilnahme an ihren Kongressen und Jahresversammlungen für alle Interessierten, wodurch sie sich im Laufe der Zeit eine breite und heterogene Teilnehmendenschaft schuf (Sauerteig, 1999).“ (Berlekamp 2021, S. 6, in Reifegerste/Sammer)