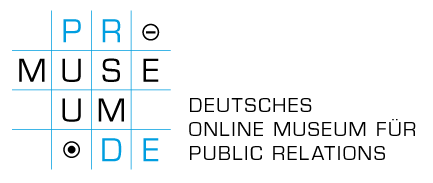Kommunikation im „langen“ 19. Jahrhundert: Einleitung und Akteure
Soziale Differenzierung und Zugänge zur Medizin
Für die allgemeine und politische Geschichte im 19. Jahrhundert und den geografischen Bezugsrahmen unserer Abhandlung ist bedeutsam, dass das alte deutsche Reich bzw. der nachfolgende Deutsche Bund an der Rivalität zwischen Preußen und Österreich scheiterte. Die Abb. zeigt einen Gedenkplatz auf dem Militärfriedhof von Königgrätz (heute Hradec Králové/CZ), wo 1866 eine folgenreiche Schlacht stattfand. Die Nationalstaatsbildung unter Führung Preußens führte 1871 zur Gründung eines deutschen Kaiserreichs ohne Österreich. Foto: Tobias Liebert (2020).
Im 19. Jahrhundert gelang die Einbeziehung potentiell aller Individuen in die Rezipientenschaft der Massenmedien (vor allem der Presse) und damit in eine – jedenfalls formal – gesamtgesellschaftliche Öffentlichkeit. Die quantitativ sich ausdehnende und differenzierende Medienlandschaft ermöglichte es vor allem ab ca. 1830 nicht nur Privilegierten und dem Bürgertum, sondern auch „Arbeiterschaft und Vereinen die Publikation eigener Zeitungen und Journale“ (Pohl 1989, S. 16).
Die medial-öffentliche Einbeziehung aller Schichten und Kreise geschah in Deutschland allerdings unterschieden in weltanschauliche Gesinnungsgemeinschaften bzw. soziale Milieus, deren politische bzw. verbandschaftliche Strukturen – so bei der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung oder der Anhängerschaft des katholischen Zentrums – häufig Angebote für die gesamte Lebenswelt vorhielten (politische Repräsentation, gewerkschaftliche Interessenvertretung, kulturelle Bildung, Geselligkeit etc.). Diese milieuspezifische Beratung und Organisation vieler Alltagstätigkeiten dürfte auch den Zugang zu medizinischen Informationen und Leistungen beeinflusst haben, z. B. über Aufklärungsabende von Kulturvereinen, Vorträge von politisch sympathisierenden Ärzten, gesundheitsbezogene Dienstleistungen von Gewerkschaften u.Ä. Zum „Armenarzt“ siehe auch in: von der Dunk (2004, S. 79). Nicht zu vergessen sind die punktuellen und ortsspezifischen, aber traditionsreichen karitativen Angebote der Kirchen und Wohltätigkeitsorganisationen.
Durch die Bismarcksche Sozialgesetzgebung im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts war im Prinzip auch der Zugang zu medizinischer Versorgung für gewerbliche Arbeiter vorgesehen. Ausgewählte Großbetriebe schufen auf betrieblicher Ebene im Rahmen ihrer sozialen Fürsorgemaßnahmen auch medizinische Angebote (siehe dazu hier im PR-Museum die Beiträge über Krupp, Unterkapitel „Interne Kommunikation“, oder Siemens, Unterkapitel „Interne PR“). In manchen Klein- und Mittelbetrieben dürfte – zumindest bei medizinisch offensichtlichen Notlagen – das paternalistische bzw. „familiäre“ Auge des Unternehmers auf den Beschäftigten geruht haben.
Medizinische Akteure
Abgesehen von den geschilderten Situationen hat insbesondere für das Bürgertum, die ländliche Bevölkerung, die Handwerkerschaft und die „Arbeiteraristokratie“ in den Städten Folgendes gegolten:
Traditionell fungierte bei gesundheitlichen Beschwerden im deutschsprachigen Raum bis zum 20. Jahrhundert die Hausarztpraxis als erster und wichtigster Kontaktpunkt für Patientinnen und Patienten. Da sich Arzt und Patient oftmals seit Jahren kannten und auch ganze Familien vom gleichen Dorfarzt versorgt wurden, stellte der Hausarzt eine Konstante im Leben eines Menschen dar. Oftmals war dieser so nicht nur mit der Krankenakte des Patienten, sondern auch mit der zugehörigen Familiengeschichte vertraut, die in den Behandlungsverlauf und -erfolg mit einfloss (Fogarty 2001).
(Rothenfluh/Schulz in Rossmann/Hastall 2019, S. 58)
Das Krankenhaus als wichtiger medizinischer Akteur und Ausbildungsstätte für Ärzte war erst um 1800 ins Licht der Öffentlichkeit getreten. Als „maßgeblicher Ort medizinischer Forschung hat [es] sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts weitgehend durchgesetzt.“ Einzelne solcher „moderner“ Einrichtungen gab es aber schon eher. „Das vermutlich erste im deutschen Sprachraum etablierte ‚Krankenhaus‘ unter dieser Bezeichnung, das 1667 eröffnete domkapitelsche Krankenhaus in Regensburg, beschäftigte medizinisches Personal und konnte die Mehrzahl der dort Behandelten wieder als geheilt entlassen.“
Mit Medizin wenig zu tun hatte das mittelalterliche Hospital (bzw. Spital). Ein „Kranken“-Haus seinerzeit als Hospital war ein Haus für (abzusondernde) Kranke, nicht aber für ihre Behandlung und Heilung. (Dross 2021) Auf manchen medizinischen Teilgebieten hielten sich solche Funktionsverständnisse zumindest als öffentliche Vorurteile durchaus länger. Noch anfangs des 20. Jahrhunderts hielt es ein medizinischer Autor für nötig zu betonen:
Die Irrenanstalt ist kein Zuchthaus, sondern ein Krankenhaus.
(Rittershaus 1913, S. 242)
Mindestens im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts waren Krankenhäuser als Behandlungsort auch für Arbeiter und ihre Familien relevant. Das Unfallversicherungsgesetz von 1884 trug den neu entstandenen Berufsgenossenschaften (BGs) Unfallverhütung und Heilverfahren als Aufgaben auf. Deshalb gründeten die BGs eigene Krankenhäuser. Die bergmännische Knappschafts-BG eröffnete am 15. Februar 1890 das „Bergmannsheil“ in Bochum und am 8. September 1894 das „Bergmannstrost“ in Halle (Saale). Letzteres zählt damit zu den ältesten Krankenhäusern im heutigen Sachsen-Anhalt.
Dabei wurde die umfangreiche Palette der Chirurgie gepflegt, so dass das Bergmannstrost ein gesuchtes Krankenhaus für die Ausbildung von Assistenzärzten wurde. Einen weiteren Anteil der Tätigkeit machten die wissenschaftlichen Leistungen aus […].
(Bergmannstrost 2024, S. 6)
Zur Zahnmedizin
Der Prozess akademischer Ausdifferenzierung und Institutionalisierung in der Medizin schritt weiter voran, bezog aber die Zahnmedizin recht spät ein. „Die medizinischen Fakultäten wehrten sich viele Jahre erfolgreich gegen die Aufnahme von Zahnärzten. […] Erst 1884 wurde in Berlin das erste zahnärztliche Institut an einer Universität etabliert. Und die Zahnärztinnen mussten bis zur Jahrhundertwende warten, bis sie in Freiburg und Karlsruhe eine universitäre Ausbildung genießen konnten.“ (Zastrow/Schmitt 2023, S. 46f.)
Deutlich eher bzw. häufiger als von universitär ausgebildeten Zahnärzten konnten Patienten und Patientinnen von so genannten (unstudierten) Dentisten behandelt werden. Letztere waren Zahnheilbehandler ohne wissenschaftliche Grundbildung, die aber eine Dentistenschule besucht haben mussten.
Noch 1919 gab es in Deutschland doppelt so viele Dentisten wie Zahnärzte. Erst 1952 wurde dieser Dualismus durch die Eingliederung der praktizierenden Dentisten in die Zahnärzteschaft aufgelöst (Groß 2015).
(zit. in Zastrow/Schmitt 2023, S. 46)
Die Dentisten der Neuzeit waren aus den „fahrenden Zahnkünstlern“ hervorgegangen. „Im Mittelalter war die Zahnmedizin das Feld der Bader und Barbiere […]. Manchmal half der örtliche Schmied aus. Gelegentlich kamen reisende Zahnkünstler ins Dorf, die schmerzende Zähne mit noch schmerzvolleren Mitteln zogen.“ (Zastrow/Schmitt 2023, S. 46)
Intervenierende Obrigkeit/Verwaltung und sich differenzierende (auch gegnerische) Öffentlichkeit
Schon früher waren staatliche und administrative Stellen wichtige gesundheitsbezogene Akteure und auch die Wurzen einer medienvermittelten Öffentlichkeit reichten bereits weiter zurück. Ausmaße und Differenzierung von einerseits Bürokratie und andererseits Öffentlichkeit gerade auch in gesundheitsrelevanten Bereichen nahmen nun aber wesentlich zu. Insbesondere im Kapitel (16) „Gesundheitspolitik, öffentliche Hygiene und Aufklärung“ kommen wir darauf noch einmal zurück.
Hier sei zunächst einmal darauf hingewiesen, dass Politik bzw. Staat ihre gesundheitsbezogenen Interventionen (bzw. Interventionsversuche) deutlich erhöhten. Ein Beispiel dafür ist die Impfgesetzgebung und ihre Durchsetzung. „Im Jahr 1874 kam es in Deutschland zur Verabschiedung des ersten Reichsimpfgesetzes zum Schutz vor Pocken, einer der schrecklichsten Seuchen mit hohen Opferzahlen“, damals auch Blattern genannt. Die Impfstrategie war gepaart mit Maßnahmen zur Verbesserung der Hygiene. (Lenz 2024, S. 41 und 47)
Die regionalgeschichtliche Studie von Lenz (2024, S. 44-50) zeigt am Beispiel einer Schule, des Domgymnasiums, in Naumburg (Saale) auf, wie detailliert und aber vergleichsweise effizient die Umsetzung der Vorgaben und Richtlinien des (damals noch: Obrigkeits-) Staates erfolgte. Alles in allem scheint die Impfung eine hohe Akzeptanz gehabt zu haben, allerdings gibt es auch einige Belege für Unverständnis bzw. Impfgegnerschaft.
Was Deutschland insgesamt betrifft, organisierte sich (…)
[b]ereits um 1880 […] eine Impfgegnerszene […], die auch alsbald eine eigene Zeitschrift herausbrachte: ‚Der Impfgegner‘, Erstausgabe vom Januar 1883.
(Lenz 2024, S. 51)
Interessant ist, woraus sich die Argumente speisten: In vielen Fällen lehnten sie sich „an den wissenschaftlichen Meinungsstreit an (Impfen versus Milieu)“. Gemeint ist damit wohl vor allem die (…)
[b]esonders kontrovers[e …] Diskussion zwischen Max von Pettenkofer und Robert Koch: Pettenkofer betrachtete die Seuche als Ganzes (er betrachtete den Keim als notwendige, aber nicht alleinige Ursache der Seuche), Koch dagegen fokussierte auf die Vernichtung des spezifischen Erregers und die Unterbrechung von Infektionsketten.
(Lenz 2024, S. 51)
Abgesehen vom wissenschaftlichen Meinungsstreit gab es auch noch andere Quellen damaliger Impfgegnerschaft. Da „Schutzpocken“, also tierisches Krankheitsmaterial, in den menschlichen Körper eingespritzt wurden, gab es ethische Bedenken insbesondere von Vegetariern oder schlichtweg Ängste vor dem „Piksen“ oder vor Komplikationen. Manche Gegenargumente waren auch „einfach nur eigenwillig“. (Lenz 2024, S. 51)
Im 19. Jahrhundert war schon erkennbar, dass „öffentliche Meinung“ weder zu sachlichen (z.B. medizinischen) noch zu politischen Fragen und erst recht nicht die Bevölkerungsmeinung dazu als homogenes und rein obrigkeitstreues oder expertenhöriges Phänomen verstanden werden kann. Trotz des Fehlens von Demokratie als Staatsform und unter den Bedingungen des – beschränken wir uns hier auf das heutige Deutschland: – königlich-preußischen und ab 1871 kaiserlich-deutschen Obrigkeitsstaates konnten sich – in Grenzen – legaler Widerstand und Alternativpositionen gegen – bestimmte – Teile der Staats- bzw. Regierungspolitik öffentlich artikulieren und formieren sowie Medien dafür einsetzen. Nach dem Fall des Bismarckschen Ausnahmegesetzes („Sozialistengesetz“) gegen die Sozialdemokratie 1890 galt dies sogar – in Grenzen – für grundlegende gesellschafts- und staatspolitische Fragen und Alternativen.
Schon damals zeigte sich am Beispiel der Impfpolitik, dass gesamtgesellschaftliche Akzeptanz wesentlich davon abhängt, ob es in einer modernen, medienvermittelten Öffentlichkeit gelingt, die unterschiedlichen Ebenen fachlich-wissenschaftlicher und politisch-administrativer bzw. gesellschaftspolitischer Argumentationen und Entscheidungen in ihren jeweiligen (unterschiedlichen) Folgen für Wissenschaft und Gesellschaft (soziales Gemeinwesen, Individuen, Wirtschaft …) klar herauszuarbeiten, zu priorisieren und jedenfalls nicht unterschiedslos zu vermengen.