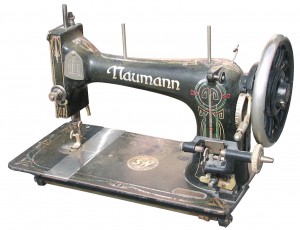Lingners Werdegang und Kommunikationserfolge
Jugendzeit und erste Werbeerfahrungen
Abb.: Eine Nähmaschine aus der Firma Seidel und Naumann. Foto: Norbert Schnitzler. Quelle: Wikimedia Commons http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
Karl August Lingner wurde am 21. Dezember 1861 in Magdeburg im heutigen Sachsen-Anhalt geboren. Im damaligen Preußen wurde in jenem Jahr Wilhelm I. neuer König, weltpolitisch gerieten aber die USA mit dem beginnenden Bürgerkrieg ins Blickfeld. Damals konnte noch niemand ahnen, welche Führungsrolle die USA später einmal in Wirtschaft, Lebensweise und Massenkonsum einnehmen würden – dank solcher Veränderungen und Trends, von denen bald auch der erwachsene Lingner in Deutschland profitieren würde.
Lingners Karriere war ihm allerdings nicht in die Wiege gelegt. Er stammte aus einfachen Verhältnissen, die eine höhere Schulbildung nicht ermöglichten.1 Einer elterlichen Vorgabe folgend absolvierte er eine kaufmännische Ausbildung in einem Gardelegener Warenladen, obwohl seine Liebe eigentlich der Musik galt.2 Nach der Lehre verblieb er weitere vier Jahre in Gardelegen. Anschließend ging er seinem ehrgeizigen Wunsch nach einem Musikstudium in Paris doch nach, was leider aber nicht gelang.3 Die Pariser Zeit und ggf. auch eine Reise nach London sollten aber für Lingner durchaus prägend werden: Zum einen sah er dort die seinerzeit moderne und omnipräsente Reklame.4 Und zum anderen erlangte er Weltläufigkeit und Fremdsprachenkenntnisse.
Formal erfolglos kehrte er 1885 nach Deutschland zurück. Die Gründerkrise hier war überwunden, das Reich stand am Beginn einer erneuten Wachstumsperiode. Alles in allem befand sich Deutschland in der Hochindustrialisierung, die auch die ursprünglich weit verbreitete agrarisch-dörfliche Lebensweise in eine industriell-städtisch geprägte wandelte. Lingner fand eine Anstellung bei der Nähmaschinenfabrik Seidel & Naumann in Dresden als Korrespondent. Für die Firma formulierte er deutsche und französische Werbe- und Geschäftsbriefe, die sich vom in Deutschland bislang üblichen Stil einer seriösen, eher steifen Geschäftssprache abhoben. Lingner wählte einfache, verständliche Worte, zeigte den Nutzen des umworbenen Produktes auf und in einer dialogischen Form schloss er die Kundenwünsche mit ein.5 Um in dieses Tätigkeitsfeld intensiver einzutauchen, beschäftigte er sich mit „Methoden der Werbung“, was auch eine Analyse amerikanischer Literatur einschloss.6
Produkt- und Kommunikationsinnovationen prägten Lingners Wirken
In der Dresdner Nähmaschinenfabrik lernte Lingner den Techniker Georg Wilhelm Kraft kennen.7 Beide wagten den Schritt als Jungunternehmer und gründeten im Juli 1888 die Firma Lingner & Kraft. Eine ideale Symbiose: Kraft konstruierte und Lingner vermarktete die entworfenen Produkte, z. B. einen Patent-Wasch-Frottierapparat (mit der Luffa-Gurke8), ‚Famos‘ (einen Stiefelzieher), das ‚biegsame Stahl-Lineal‘ sowie den ‚Dochtputzer‘ für Petroleumlampen.9 Schon bei den Produktbezeichnungen zeigte Lingner Einfallsreichtum: Büchi 2006 (S. 38) beschreibt den Stil als „Werbe-Poesie“, die beispielsweise das einfache Luffa-Stück in einen „Schönheitsschwamm“ verwandelt. Für die Vermarktung wählte Lingner die Annoncenschaltung in Form des Inserates, da Zeitungen und Zeitschriften im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ihren Siegszug als Massenmedium antraten. Die Anzeigen bestanden aus „Bildillustrationen“ (Funke 2001, S. 10) und einem Werbetext, der die Leser ansprach und mit Nutzens-Argumenten zu überzeugen versuchte.
Beispielsweise bezogen auf die Anzeige des Luffa-Schwammes führt Büchi 2006 (S. 38) folgende Text-Merkmale an: den Zeit- bzw. Aktualitätsaspekt („dass jetzt die beste Zeit ist [also jetzt oder nie])“, die Nützlichkeit („bequem und schnell“), die Wirkung („frisch, froh und gesund“), die Alltagstauglichkeit und zugleich statusbetonte Zielgruppenansprache („Dieses Gerät gehöre wie Zahnbürste und Seife ‚auf jeden Waschtisch jedes Gebildeten’“).
Nach vier Jahren, im März 1892, schied Kraft aus dem Unternehmen aus und Lingner führte dieses alleine weiter.10 Beide verfolgten neue Interessensgebiete, Lingner wandte sich verstärkt chemisch-pharmazeutischen Erzeugnissen zu. Da trat der Chemiker Dr. Richard Seifert11 mit einer Idee heran und besprach mit Lingner die Vermarktungsmöglichkeiten einer neuen antiseptischen Substanz. Unter den Varianten Hautcreme, Toilettenseife und Mundwasser entschlossen sich beide für Letztere: Damit war die Stunde des Markenartikels „Odol“ gekommen. Lingner gründete im Oktober 1892 ein zweites Unternehmen, das Dresdner Chemische Laboratorium Lingner, die späteren Lingner-Werke.12
Sowohl das Odol-Mundwasser als auch Karl August Lingner als Unternehmer nahmen einen rasanten Aufstieg. Lingner beschäftigte sich eingehend mit Desinfektion und Hygiene, wurde dadurch auch zum Aufklärer und Philanthropen.
Lingners Leben endete recht früh. Er starb am 5. Juni 1916 an den Folgen einer Zungenkrebserkrankung. Das so genannte Lingnerschloss, die von Lingner bewohnte Villa Stockhausen auf den Elbhöhen, und das von ihm 1912 gestiftete Deutsche Hygiene-Museum erinnern noch heute in Dresden an ihn.
Anmerkungen
1 Die unsicheren Einkünfte der Familie, die vier Kinder großzog, wurden hauptsächlich durch die Tätigkeit des Vaters, August Bernhard Lingner (1828-1878), erzielt. Er war ein „Handelsagent oder Kommissionär, Zwischenhändler also für dieses oder jenes.“ (Büchi 2006, S. 17)
2 Karl Augusts – wie einige Autoren behaupten: – außergewöhnliche Begabung für Musik entstand bereits in den Jugendjahren, sie erschien den Eltern aber als eher aussichtslos. Sie schickten ihn in einen Warenladen, wo er die Ausbildung (1877-79) gezwungenermaßen absolvierte, wie Wollf (1930, S. 23f., 58), sein späterer Biograf und engster Freund, anmerkt. Hingegen meint Funke (2001, S. 7), dass ein Berufsabschluss von Karl August Lingner nicht nachweisbar und es nicht konkretisiert ist, ob eine kaufmännische oder vielleicht sogar eine Drogistenausbildung erfolgte.
3 Die Recherchen vom Deutschen Hygiene-Museum, Funke 2001 (S. 7) und Büchi 2006 (S. 26f.) ergaben, dass eine Eintragung zu Karl August Lingner im ‚Conservatoire de Paris‘ nicht aufgeführt ist.
4 Frankreich, England und Amerika galten als Vorreiter in der Reklame und deutsche Firmen (beispielsweise Bahlsen, Oetker, Kaffee-HAG) organisierten gezielt Auslandsaufenthalte zum Erlernen der dortigen Reklamestrategien. Lamberty 2000 (S. 122) sieht Lingners Aufenthalt in Paris als einflussgebend für sein späteres Berufsleben. Funke 2001 und Büchi 2006 hingegen enthalten keinerlei Ausführungen zu einer gezielten Auseinandersetzung mit Reklame in Paris. Nach Ausführungen von Wollf 1930 (S. 30f.) gab es kurz vor der Deutschlandrückkehr eine Reise nach London, die aber Funke 2001 (S. 8) skeptisch betrachtet. Für die letzte Zeit des Parisaufenthaltes hatte Lingner mit einer schwerwiegenden Erkrankung zu kämpfen.
5 Büchi 2006, S. 34; Funke 2001, S. 7.
6 Funke 2001, S. 8; Wollf, S. 37f.
7 Georg Wilhelm Kraft wurde 1855 geboren und lebte voraussichtlich bis 1929 (genaues Datum ist unsicher). Als Berufsbezeichnung ließen sich die Titel Werksführer, Techniker und Ingenieur finden (vgl. Funke 2001).
8 „Der Luffa-Schwamm besteht aus dem gebleichten Gefäßbündelnetz einer in Ägypten und Japan beheimateten Gurkenart.“ (http://lingner-archiv.jimdo.com/lingner-biographie/erste-berufl-jahre/)
9 Es gab auch weniger erfolgreiche Produkte, wie den ‚Senfbrunnen‘. Vgl. die detaillierten Ausführungen von Büchi 2006, S. 41.
10 Für die Trennung von Kraft gibt es verschiedene Erklärungen. Funke 2001 (S. 10f.), Hodgson 1993 (S. 32) und Büchi 2006 (S. 42) halten die Version eines freiwilligen Ausscheidens von Kraft für wahrscheinlicher.
11 Richard Seifert lebte von 1861 bis 1919. Ab 1885 arbeitete er in der Heydenschen Chemiefabrik. Seine Verbesserung der Kolbeschen Salicylsäuresynthese brachte ihm 1886 eine Patentierung des Salols ein. Vgl. Funke 2001, S. 12; Büchi 2006, S. 46, 64.