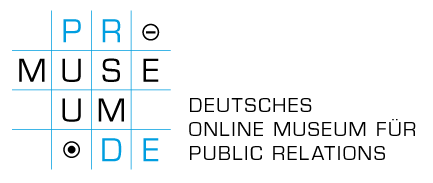Wilhelm II. zog in den Krieg
Strategien und Praktiken der Inszenierung und Profilierung (Fortsetzung)
4. Der kriegsbegeisterte Kaiser: Wilhelm II. zog in den Krieg
Abb.: Erzherzog und österreichischer Thronfolger Franz Ferdinand, dessen Ermodung 1914 den Anlass für den Ersten Weltkrieg bildete, bei einem „Kaisermanöver“ in Süddeutschland 1909 (vorn, Erster von rechts). Foto von Oscar Tellgmann. Quelle: Wikimedia Commons, Bundesarchiv Bild 136-C0681 (gemeinfrei).
Auch vor und während des Ersten Weltkrieges leistete das Deutsche Reich – allen voran der Kaiser – vielseitige Öffentlichkeitsarbeit. Auf der einen Seite wurde die deutsche Siegeszuversicht zelebriert und in aufwendigen Kampagnen für den Verkauf von Kriegsanleihen geworben. Auf der anderen Seite bemühte sich Wilhelm II. bei seinen zahlreichen Reisen ins Ausland um Verständnis für die deutsche Sicht der Dinge (vgl. Kunczik/Zipfel 2002, S.18).1
Abb.: Totenbett und Uniform des in Sarajevo ermordeten Erzherzogs Franz Ferdinand im Heeresgeschichtlichen Museum zu Wien. Foto: Sandstein. Quelle: Wikimedia Commons http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode
Als der österreichisch-ungarische Kronprinz Franz Ferdinand im Sommer 1914 in Sarajevo ermordet wurde, war der deutsche Kaiser davon sehr betroffen. Wohl nicht, weil er den Thronerben der Donaumonarchie so sehr mochte, sondern weil er die Monarchie generell bedroht sah. „Nach außen dagegen markierte er den starken Mann: Im Taumel der Kriegsbegeisterung, der die Deutschen in den heißen Augusttagen 1914 erfasste, flammte der zunehmend abgenutzte Mythos des Monarchen noch einmal auf“. (Rogasch 1991, S. 98 und 101f.)
In seiner Rede vom 1. August 1914 tätigte der Kaiser den Ausspruch „Ich kenne keine Parteien mehr, nur noch Deutsche!“. Dieser Satz wurde in den ersten Kriegstagen dutzendfach wiederholt und variiert. Wilhelm II. hatte es mit dieser populistischen Aussage geschafft, die Sozialdemokraten zur Bewilligung der Kriegskredite zu bringen. Durch „Not und Tod“, durch „dick und dünn“ wollte Wilhelm die Opposition bewegen, unter Verleugnung jeglicher Konfessionsunterschiede und politischen Gesinnung, dem Krieg zuzustimmen. Damit hatte es der Kaiser letztlich doch noch geschafft, in seiner zugedachten Rolle als Integrationsfigur Deutschlands zu glänzen und das deutsche Volk gemeinsam hinter sich zu scharen (vgl. Rogasch 1991).
Der Erste Weltkrieg war zugleich der Erste, bei dem es nun technisch möglich war, den Krieg in all seinen Facetten fotografisch darzustellen. Die Technik ermöglichte es aber auch, die Fotografien für Propagandazwecke im In- und Ausland einzusetzen. Zudem verschwanden zunehmend moralische Bedenken beim Einsatz dieses Mediums. „Somit stand einem vielfältigen und sehr komplexen Einsatz der Fotografie in Kriegszeiten nichts mehr im Wege“. (vgl. Asser/Ruitenberg 2002, S. 66)
Erzwungener Abgang und Versuch, den Mythos zu erhalten: das Ende des Kaiserreiches und Exil
Abb.: Kaiser Wilhelm II. auf dem Weg ins Exil am 10.1.1918. Am belgisch-niederländischen Grenzübergang Eysden verabschiedete er sich von seinem Gefolge. Quelle: Bundesarchiv, Bild 183-R12318 / CC-BY-SA http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de
Abb.: Der ehemalige Kaiser Wilhelm II. mit seiner Frau im niederländischen Exil Landsitz Haus Doorn im September 1933. Foto von Oscar Tellgmann. Quelle: Wikimedia Commons, Bundesarchiv Bild 136-C0805 (gemeinfrei).
Nach dem Scheitern Deutschlands im Ersten Weltkrieg flüchtete Wilhelm II. ins Exil nach Doorn in den Niederlanden.
Die Sympathien für das Kaiserhaus hatten im Zuge des militärischen Zusammenbruchs und wirtschaftlichen Bankrotts stark nachgelassen.
Von den Niederlanden aus beauftragte der gescheiterte Monarch weiterhin Bilder von sich, um den Mythos um seine Person, den er kurz vor Ausbruch des Krieges erlangt hatte, aufrecht zu erhalten. Auf seine Person und Dynastie bezogen vergebens, allerdings trauerten viele in der Weimarer Republik der 1920er- und 1930er-Jahre der deutschen Kaiserzeit vor 1914 nach.