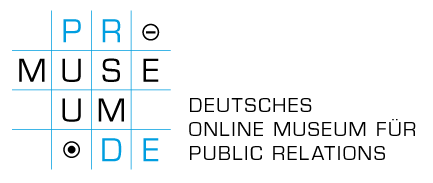Öffentlichkeitsgeschichtlicher Hintergrund
Politik- und Medienentwicklung: Öffentlichkeit nahm an Bedeutung zu
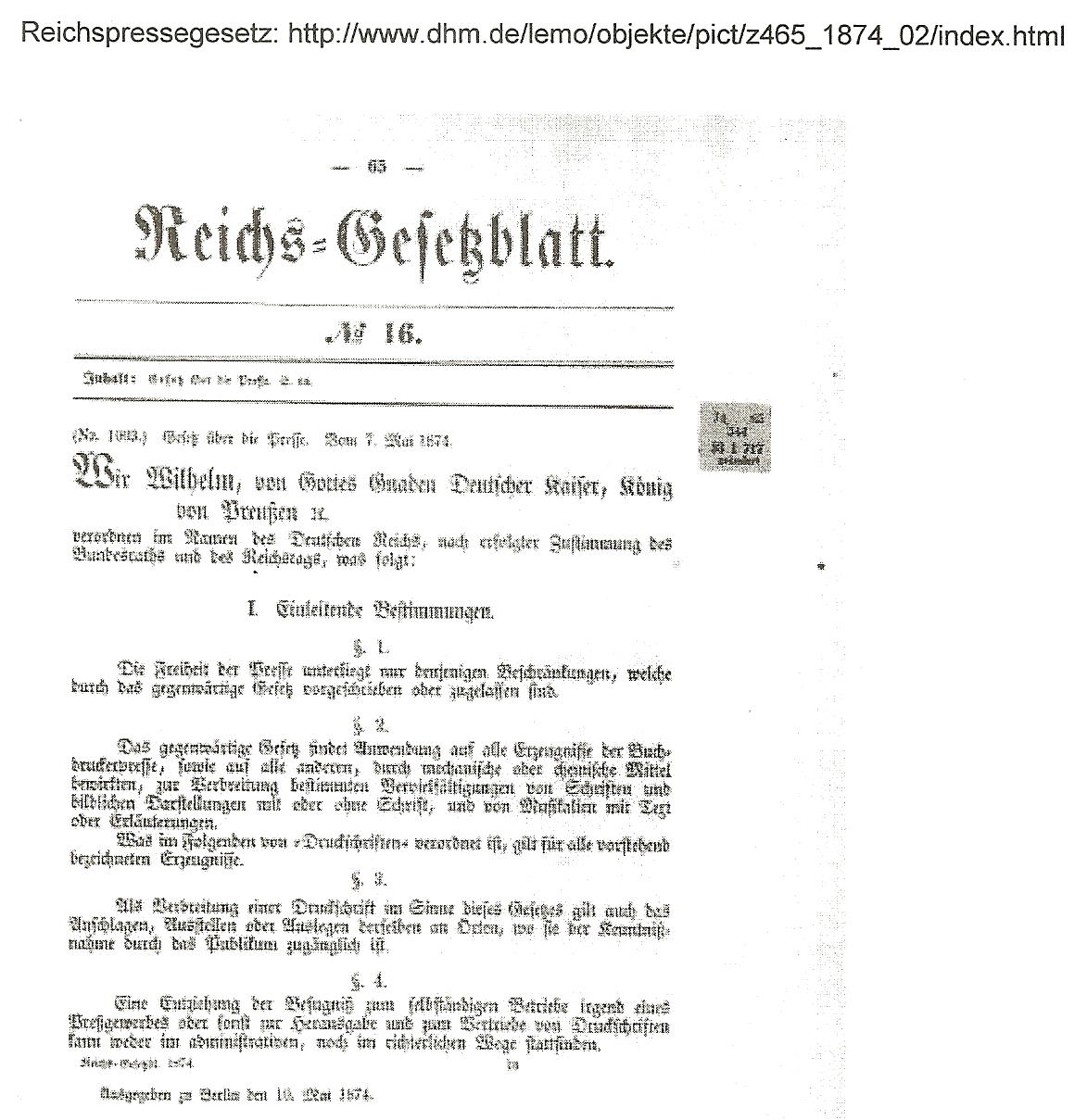
Abb.: Gesetz über die Presse vom 7. Mai 1874. In: Reichs-Gesetzblatt Nr. 16. Berlin, 1874. Hier als Wiedergabe eines Exemplars des Deutschen Historischen Museums Berlin, LeMo-Chronik 1874. https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/gesetz-ueber-die-pressefreiheit-1874.html
Mit zunehmender Nachfrage nach allgemeinen Nachrichten und wirtschaftlicher sowie politischer Berichterstattung vermehrten und differenzierten sich auch Anzahl und Charakter der Medien – und der Versuche, auf Medien einzuwirken. Vor allem kam es zu einem quantitativen Aufschwung und einer Ausgestaltung der Presselandschaft – und damit auch zu mehr Pressearbeit. Jene Entwicklungen leisteten einen Beitrag dazu, dass die öffentliche Meinung gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu einem „manipulierbaren Instrument des politischen Kampfes und der Machtausübung“ (Deist 1976, S. 17) wurde.
Eine wichtige Bühne politischer Öffentlichkeit stellte der Reichstag dar. Diese Volksvertretung wurde in allgemeinen direkten und geheimen Wahlen – allerdings nur von Männern – gewählt. Zwar war er – gemessen an demokratischen Maßstäben – auch ansonsten kein vollwertiges Parlament und wurde von monarchistisch-obrigkeitsstaatlichen Strukturen bzw. Prozeduren eingeschränkt. Der dennoch vorhandene Einfluss des Reichstags gründete im Kaiserreich – einer konstitutionellen Monarchie – darauf, dass der Reichskanzler in Bezug auf Budget- und Gesetzesfragen seine Zustimmung benötigte. In Artikel 5 der Reichsverfassung von 1871 heißt es:
Die Reichsgesetzgebung wird ausgeübt durch den Bundesrat und den Reichstag. Die Übereinstimmung der Mehrheitsbeschlüsse beider Versammlungen ist zu einem Reichsgesetz erforderlich und ausreichend. Bei Gesetzesvorschlägen über das Militärwesen, die Kriegsmarine und die im Artikel 35 bezeichneten Abgaben gibt, wenn im Bundesrat eine Meinungsverschiedenheit stattfindet, die Stimme des Präsidiums den Ausschlag, wenn sie sich für die Aufrechthaltung der bestehenden Einrichtungen ausspricht
(Verfassung des Deutschen Reiches 1871, S. 13; Rechtschreibung modernisiert).
Damit besaß der Reichstag eine gewisse Macht, der sich auch der Kaiser zu unterwerfen hatte. Dies zeigte sich vor allem unter Wilhelm II., der für die militärische Aufrüstung und den Flottenbau die Zustimmung des Reichstags benötigte.1
Öffentlichkeitswandel durch sozialökonomische und kulturelle Veränderungen
Weiter vorn hatten wir bereits auf den Politik- und Stilwandel aufmerksam gemacht, der mit dem Übergang von Bismarck zu Wilhelm II. einherging. Zweifellos beeinflussen persönliche Eigenschaften einflussreicher Akteure die von ihnen gestaltbaren Verantwortungsbereiche und ihr Auftreten in der Öffentlichkeit.2 Umgekehrt sind aber auch der individuelle Umgang mit Öffentlichkeit bzw. Gesellschaft wie auch deren intersubjektive Funktionsmechanismen Ausdruck tieferliegender sozialökonomischer und kultureller Prägungen bzw. Prozesse.
Die vielen wissenschaftlichen Erfindungen, technologischen Fortschritte, Ingenieursleistungen und daraus resultierenden ökonomischen Erfolge vor allem ab den 1890er-Jahren schufen eine Realität und noch mehr einen Erwartungs- und Machbarkeitshorizont, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellte. Größter Treiber und Profiteur dieser Entwicklung war das erstarkende Bürger- und insbesondere das Großbürgertum, das zwar nicht politisch, aber wirtschaftlich zur mächtigsten sozialen Schicht oder Klasse aufstieg. Eben weil es nicht gleichermaßen an der politischen Macht beteiligt wurde, musste es sich mit den bisher politisch Herrschenden arrangieren.
Dadurch – und die tiefen Widersprüche politisch-national überbrückend in der Reichsgründung – veränderten sich die Gewichte in der Öffentlichkeit und die Stimmung in der Gesellschaft.
Es war die Stimmung der bürgerlichen Gesellschaft und Öffentlichkeit, die Stimmung des Kaisers und des außenpolitischen Establishments. Es war die Stimmung eines neuen Aufbruchs voller Vitalität und voller Kraftgefühl, auf der Höhe der Kultur, getragen vom gewaltigen wirtschaftlichen Fortschritt, mit dem Anspruch auf Zukunft, auf Teilnahme an der Gestaltung der Welt, auf Weltgeltung und auf Macht. Europa war in das Zeitalter des Imperialismus eingetreten
Öffentlichkeits- und Stimmungswandel schlägt auf Außenpolitik und Haltung zu einem eventuellen Krieg durch
Die deutsche Außenpolitik geriet in ein Dilemma zwischen Sicherheits- und Weltpolitik. Allerdings nahm das Deutsche Reich durch den Wunsch nach Prestigegewinn und die Neigung zum Auftrumpfen die Gefährdung der Sicherheit in Kauf.3 Das Expansionsstreben fand einen breiten Konsens in bürgerlichen wie agrarisch-konservativen Schichten und es bestand die Bereitschaft, einen allgemeinen Krieg hinzunehmen, um materielle oder ideelle Erfolge zu erzielen.4
Für diesen breiten Konsens – vor allem bezüglich der Möglichkeiten und Chancen – bildeten offensichtlich die Figur und Politik Wilhelm II. – trotz oder gerade wegen seiner persönlichen Schwächen oder Widersprüchlichkeiten – eine geeignete Projektionsfläche. Bernhard von Bülow, seit 1897 Staatssekretär des Äußeren und ab 1900 Reichskanzler, schrieb über Wilhelm II., zehn Jahre nachdem dieser den Thron bestiegen hatte:
Er verbindet in einer Weise, wie ich es nie gesehen habe, Genialität, echteste und ursprünglichste Genialität mit dem klarsten bon sens. Er besitzt eine Phantasie, die mich mit Adlerschwingen über alle Kleinigkeiten emporhebt, und dabei den nüchternsten Blick für das Mögliche und Erreichbare. Und dabei welche Tatkraft! Welches Gedächtnis! Welche Schnelligkeit und Sicherheit der Auffassung!
(Röhl 2007, S. 19).
Anmerkungen
1 Vgl. Hartmann 2013, S. 26ff.
2 Dies ist nicht nur eine historische Erkenntnis. Möglicherweise wurde seinerzeit der Wechsel von Bismarck zu Wilhelm II. ähnlich zäsurhaft empfunden wie heute die Wahl des US-Präsidenten Trump und die Etablierung des damit verbundenen Politik- und Öffentlichkeitsstiles (T.L.).