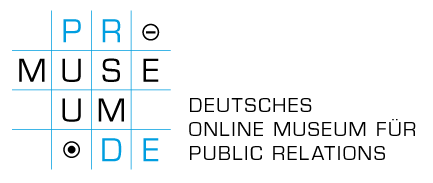Bismarck an der Macht: 1862-1867 – finanzielle und juristische Formen seiner Pressepolitik
Juristische Restriktionen und finanzielle Belastungen gegenüber der Presse
Abb.: „Macht geht vor Recht“, Karikatur aus dem Kladderadatsch, Nr. 6, vom 8.2.1863. Quelle: Wikimedia Commons, gemeinfrei.
Das desaströse Medienecho, mit dem gerade liberale Blätter die Person und Politik des neuen preußischen Ministerpräsidenten kurz nach dessen Amtsantritt quittierten, provozierte Bismarck nicht zuletzt dadurch, dass er nach der Schließung des preußischen Landtags am 13. Oktober 1862 „die Regierung gegen die parlamentarische Mehrheit und ohne ein bewilligtes Budget führte“ (Wilke 2000, S. 221). Gleichzeitig machte es ihm diese spezifische politische Situation aber auch möglich, gezielte, (im eigentlichen Sinne) pressepolitische Maßnahmen zu verabschieden, die es erlaubten, „Zeitungen, die nicht parierten, rigoros verbieten oder gerichtlich verfolgen“ (Koszyk 1966, S. 231) zu lassen.
Zu den ersten pressepolitischen Maßnahmen gehörte die Implementierung eines ministeriellen Berichtigungssystems, das oppositionelle Blätter mit Gegenanzeigen zu diskreditieren versuchte.1 Während diese Maßnahme dazu diente, die Glaubwürdigkeit kritischer Zeitungen zu erschüttern, zielte ein Großteil des pressepolitischen Instrumentariums Bismarcks in dieser Phase vor allem auf eine wirtschaftliche Schwächung vermeintlich staatsfeindlicher Publikationen ab.
Zusätzlich zu dem seit 1852 wieder gültigen Zeitungsstempel wurde deshalb ein umfassender Steuerkatalog eingeführt, der gestufte Abgaben für verschieden Blätter vorsah.2 Des Weiteren verlegte Bismarck die Regelung des Postvertriebs in den Aufgabenbereich des Staates. Ihm war es im Folgenden möglich, oppositionellen Blättern den Postdebit zu entziehen, d. h. der Post zu verbieten, indizierte Zeitungen zuzustellen. Mit den zusätzlichen steuerlichen Belastungen und dem Wegfall der Abonnement-Einnahmen wurden allein im Jahr 1866 um die 80 Zeitungen in den Ruin getrieben.3
Presseordonnanz von 1863
Die Presseordonnanz vom 1. Juni 1863 ließ Bismarck „ohne Beschlussfassung oder Zustimmung des Landtags“ (Wilke 2000, S. 221) im Namen des Königs publizieren. Diese königliche Verordnung gestattete es staatlichen Behörden, Publikationen zu verbieten, die den Unmut des Königs oder der Regierung auf sich gezogen hatten. Für die Aussprache dieses juristisch nicht näher überprüfbaren Verbots, das für die betreffende Zeitung den Entzug ihrer Konzession bedeutete, reichte die bloße Verwarnung eines einzelnen Mitarbeiters, Redakteurs oder Verlegers aus.4
Weil die wenigsten Verleger es riskierten, ihre Existenzgrundlage zu verlieren und deshalb im Sinne der Staatsmacht parierten, „kehrte die preußische Presse zu vormärzlicher Farblosigkeit zurück“ (Koszyk 1966, S. 234). Zeitungen, die nicht verboten wurden, entwickelten sich zu bloßen Verlautbarungsorganen der Regierung, der man „bisweilen sogar zugestehen musste, die Redakteure zu bestimmen“ (Koszyk 1966, S. 231).
Nach Abschaffung der Presseordonnanz: persönliche und gerichtliche Zermürbung
In der Öffentlichkeit sorgte insbesondere diese königliche Ordre für einen Sturm der Entrüstung; erstmals äußerte sich daraufhin sogar der Kronprinz öffentlich gegen die Politik seines Vaters.5 Angesichts dieser öffentlichen Empörung überraschte es wenig, als diese Gesetzesvorlage Bismarcks noch im selben Jahr durch das neugewählte Parlament für verfassungswidrig erklärt und schließlich abgeschafft wurde.
Ohne parlamentarische Rückendeckung ging Bismarck ab sofort vermehrt persönlich und hauptsächlich gerichtlich gegen widerspenstige Blätter vor. So kam es allein 1864 zu 175 gerichtlichen Presseprozessen, die hauptsächlich auf dem Tatbestand der Beleidigung fußten.6